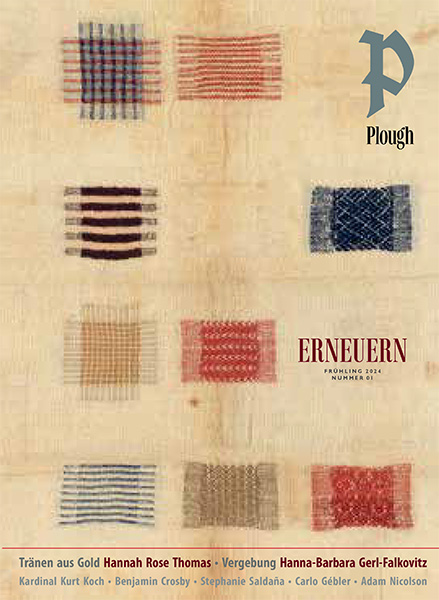Subtotal: $
Checkout
Denkmäler stürzen?
Im Berliner Stadtteil Zehlendorf gibt es die U-Bahn-Station „Onkel Toms Hütte“, benannt nach dem berühmten Roman von Harriet Beecher-Stowe. Beecher-Stowe war eine leidenschaftliche Gegnerin der Sklaverei. Sie schrieb den Roman im Jahr 1852 als ein Manifest gegen die Sklaverei. Der 22-jährige Berliner Basketball-Profi Moses Pölking, Sohn einer kamerunischen Mutter und eines deutschen Vaters, liest den Roman anders. Er als farbiger Mensch findet „Onkel Toms Hütte“ schlicht diskriminierend. „Onkel Tom“, der zentrale Charakter des Romans stehe für einen zumindest impliziten Rassismus. Das Buch zeigt das Bild eines, so Pölking, sich selbst erniedrigenden Schwarzen, das die Autorin ihren Zeitgenossen präsentierte, um auf eine weiße Gesellschaft von Sklavenhaltern nicht bedrohlich zu wirken. Darauf wollte Pölking eine Antwort geben. Er initiierte eine Online-Petition zur Änderung des Namens der U-Bahn-Station. Seine Initiative wurde in kurzer Zeit von 12.000 Personen unterzeichnet und fand eine breite öffentliche Resonanz. Dieser Vorgang ist nur ein kleines, aber sprechendes Beispiel, dem viele weitere an die Seite gestellt werden könnten: Antirassistische Proteste, Debatten um die Kontinuität kolonialer Denkmuster, Aufmerksamkeit auf Alltagsdiskriminierung – all dies findet sich auch in Deutschland in den Schlagzeilen der Medien und im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
„Alles hat seine Zeit“ – so beginnt das berühmte 3. Kapitel des Kohelet, des „Predigers Salomo“. Denkmäler werden gebaut und Denkmäler werden gestürzt – wenn die Zeit gekommen ist: das Denkmal des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol, die Statue von Cecil Rhodes vor dem Oriel College in Cambridge und das Standbild Leopolds II. in Antwerpen, des belgischen Königs, der für die Plünderung des Kongo verantwortlich war. So weit, so eindeutig. Wie aber steht es etwa um das Denkmal für Winston Churchill, des Mannes, der im Jahr 1940 den Widerstand gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland lebendig erhielt? Soll das Denkmal erhalten werden als ein Bestandteil einer Erinnerungskultur der freiheitlichen Demokratie? Oder soll es verschwinden, weil dieser Churchill ein Apologet des britischen Kolonialismus war und viele seiner Äußerungen einen tiefsitzenden Rassismus belegen?
Auch heute liegt die Versuchung nicht fern, eine identitäre Rede von einem angeblich zu verteidigenden „christlichen Abendland“ für Abgrenzungen zu benutzen.Solche Ambivalenzen lassen sich kaum eindeutig auflösen. An ihnen zeigt sich, dass die westlichen, am Ideal von Freiheit und Gleichheit orientierten Gesellschaften vor allem über ihr eigenes Selbstverständnis streiten, wenn um Rassismus, Unterdrückung und strukturelle Gewalt gestritten wird. Immerhin: es geht um einen tiefgehenden Wandel von nationalstaatlich verfassten, ethnisch relativ homogenen Gemeinwesen zu globalisierten, vielfältigen Einwanderungsgesellschaften und den entsprechenden politischen Formen von Partizipation und Repräsentation. Der Streit um die Denkmäler ist nicht trivial. Denkmäler stehen für kollektive Identitäten, sie haben identitätsstiftende Kraft – und zwar in beide Richtungen: als affirmative Selbstdarstellung eines politischen Gemeinwesens in seinen exemplarischen Individuen und – für die Bilderstürmer – als Kampf um Sichtbarkeit, Hörbarkeit, Anerkennung der Marginalisierten. Diese Auseinandersetzung hat eine globale Dimension – und sie hat je nach Kontext regionale und nationale Eigentümlichkeiten. Hier soll es um die Besonderheiten politischer Kultur der Bundesrepublik Deutschland gehen, gleichzeitig aber auch um eine geistliche, eine theologisch verantwortete Perspektive auf die Konflikte. Nicht zuletzt stehen ja auch die Ambivalenzen der christlichen Tradition, die allzu oft als Herrschaftsideologie missbraucht wurde. Auch heute liegt die Versuchung nicht fern, eine identitäre Rede von einem angeblich zu verteidigenden „christlichen Abendland“ für Abgrenzungen zu benutzen. Der christliche Glaube ist aber für freiheitliche und demokratische Gesellschaften noch etwas anderes: eine wichtige Ressource für Inklusion, Freiheit und Gerechtigkeit. Dies soll im Folgenden expliziert werden. Nach einem Blick auf die gegenwärtige Lage in Deutschland und dem Versuch einer politischen Bewertung soll abschließend ein Argument für die versöhnende Kraft des Evangeliums und den Versöhnungsauftrag der Kirchen und christlichen Gemeinschaften entwickelt werden.
Deutsche Verhältnisse im globalen Kontext
Wenn man genauer hinschaut, kann man weltweit drei verschiedene Positionen erkennen, die sich in den Debatten zu Wort melden: Es gibt erstens die progressive Stimme, die ausgleichende Gerechtigkeit für Unterdrückte und Marginalisierte einfordert. Globale Bewegungen wie „BlackLivesMatter“ und „MeToo“ machen etwa die grundsätzlichen Asymmetrien der Macht sichtbar. Die bislang Stummen und Unsichtbaren werden erstmals hörbar und sichtbar. Es gibt zweitens die liberale universalistische Stimme, die kritisch ist gegenüber der starken Betonung von Gruppenzugehörigkeiten und sich immer weiter zersplitternden Identitäten. Und es gibt drittens die Stimme derjenigen, die ihre hergebrachten Identitäten und Lebensformen verteidigen möchten, was sich mitunter zu einer weltweiten populistischen Gegenrevolution der Globalisierungsverlierer verdichtet und sich im Extremfall zu einer Flucht in regressive Phantasien einer vermeintlich homogenen Geschichte, Kultur und Religion steigert. Diese drei Stimmen ringen, ihrerseits in oft komplexen Mischungen und Zwischentönen sich überlagernd, um Deutungs- und Gestaltungsmacht in den öffentlichen Diskursen.
Das ist auch in Deutschland nicht anders. Im Frühsommer 2020 gab es auch in deutschen Städten hunderttausend Demonstrierende, die unter der Losung BlackLivesMatter nicht nur gegen die Ermordung von George Floyd demonstrierten, sondern auch strukturellen Rassismus anklagten. In Deutschland geht es dabei weniger um Aufarbeitung der vergleichsweise kurzen kolonialen Geschichte. Ein wichtiges Thema ist die Zunahme antijüdischer und antimigrantischer Straftaten, begangen vielfach durch einen äußerst gewaltbereiten, gut vernetzten Rechtsextremismus. Noch am 19. Februar 2020 ermordete ein rechtsextremer Gewalttäter in der hessischen Stadt Hanau zehn Menschen, zielbewusst Personen mit Migrationshintergrund. Untergründig wirksam ist auch ein Verdacht gegen die Staatsmacht, die sich mit den Verbrechen des so genannten „NSU“ (Nationalsozialistischer Untergrund) verbindet, einer Serie von neun Morden an Menschen mit Migrationshintergrund in den Jahren 2000-2006. Der erst im Jahr 2018 abgeschlossene Strafprozess deckte Verwicklungen des Verfassungsschutzes und nachlässige, fehlerhafte Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden auf. Spuren, die in das Innere des Polizeiapparats führten, verschärften das Misstrauen gegen Polizei und Behörden in Teilen der Gesellschaft.

Nun sind antirassistische Demonstrationen wie diejenige im Sommer 2020 in Deutschland nichts Neues. Vor allem im Anschluss an die Migrationskrise des Jahres 2015 kam es zu einer bedeutenden Mobilisierung der deutschen Zivilgesellschaft. Der große Zustrom schutzsuchender Menschen brachte die öffentliche Verwaltung an ihre Grenzen. Kanzlerin Angela Merkels berühmtes Diktum „Wir schaffen das“ konnte nur mit Leben gefüllt werden durch ein außerordentliches Engagement vieler Ehrenamtlicher vor allem in den lokalen Zusammenhängen. Die kirchlichen Netzwerke waren an vielen Orten wichtig und sogar entscheidend. 240.000 Menschen versammelten sich im Oktober 2018 allein in Berlin unter dem Motto „Wir sind mehr“, um der wachsenden Polarisierung der deutschen Gesellschaft und dem Einfluss rechtspopulistischer Politikmuster zu widersprechen. In den Jahren 2018/19 hatte die Zustimmung zur rechtspopulistischen Partei AfD („Alternative für Deutschland“) Rekordhöhen erreicht. Beides, die große Zahl der Demonstrierenden wie die Wahlerfolge der Rechtspopulisten, sind allerdings Indizien für den hohen Grad an Polarisierung in der deutschen Gesellschaft. In den Jahren nach 2015 war lange Zeit das Themenbündel Migration, Flucht, Asyl bestimmend und zeichnete die Bruchlinie („cleavage“) vor, an der entlang sich die politischen Lager bildeten. Dieses Mobilisierungsthema wurde im Jahr 2019 durch dasjenige der Klimapolitik abgelöst. Die „Fridays for Future“-Demonstrationen zeigten dann allerdings eine Politisierung der jungen Generation, wie es sie zumindest in Deutschland seit den großen Protesten gegen Atomwaffen am Beginn der 1980er Jahre nicht mehr gegeben hatte. Im Jahr 2020 hat sich die Szene noch einmal gravierend verändert. Die CoVid19-Pandemie hat die Zivilgesellschaft zunächst stumm gemacht. Der Staat, vor allem in Form der Verwaltung, bestimmte die Szene, und konnte für energisches Handeln mit überwältigender Zustimmung rechnen. Polarisierung war gestern, konnte man meinen, und so zeigten es auch die Wahlumfragen, die eine große Mehrheit für die regierende Kanzlerpartei CDU/CSU anzeigen. Umso bemerkenswerter ist dann der Mobilisierungsgrad, den die BlackLivesMatter-Proteste in Deutschland auch unter CoVid19-Bedingungen erreicht haben. Das hier zu beobachtende Mobilisierungsmuster wird den Charakter des Politischen nachhaltig beeinflussen und wohl auch verändern. Die bis an den Beginn des neuen Jahrtausends ethnisch relativ homogene deutsche Gesellschaft akzeptiert mehr und mehr, dass sie „Einwanderungsgesellschaft“ ist, wird damit auch zunehmend „postmigrantisch“ in dem Sinne, dass ethnische Zugehörigkeit nicht mehr die entscheidende Kategorie gesellschaftlicher und politischer Wahrnehmung ist. Gleichwohl ist gerade ein derartiges gesellschaftliches Selbstverständnis höchst umstritten und mobilisiert politisch. Die populistische Versuchung der Demokratie bleibt präsent und allgegenwärtig – zu bedenken ist etwa, dass bis in das Jahr 2019 hinein die rechtspopulistische AfD die Sozialdemokraten als stärkste Partei im Milieu der Industriearbeiterschaft abgelöst hat. Die Zeichen stehen auf weiteren Wandel. Mit dem durch die Klimakrise absehbaren Niedergang der Industrieökonomie steigt die Zahl der Globalisierungs- und Modernisierungsverlierer. Das gleiche trifft zu für die tiefen Veränderungen in den klassischen Geschlechterrollen, auch sie mit dem Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsökonomie verbunden. Der Gegensatz zwischen einer schnellen, dynamischen, universalistisch ausgerichteten globalen Kultur individueller Menschenrechte und einer langsamen, retardierenden, partikular verwurzelten Kultur kollektiver Zugehörigkeiten wird wohl das Feld bestimmen – in vielfältigen Brechungen, Überschneidungen und Mischungen. Die Identitätsdebatten werden noch unübersichtlicher.
Erinnerungskultur und politische Öffentlichkeit
Wo Denkmäler gestürzt werden, geht es immer auch um Erinnerungskulturen und die damit verbundenen Geschichtspolitiken, in denen sich auch die Gräben zwischen den gesellschaftlichen und politischen Lagern und Gruppen abbilden. Welche Erinnerungen – immer eine Selektion aus dem unübersehbaren Bestand des historisch Gegebenen – sind maßgeblich, kanonisch, bestimmen die kollektive Identität des Gemeinwesens? Die maßgeblichen Erinnerungen sind dem öffentlichen Raum eingeschrieben in Form von Bauten, Straßennamen oder eben Denkmälern; sie sind dem öffentlichen Zeitregime eingeschrieben über Gedenktage, Feste, Jubiläen oder auch, denken wir an den 27.1. als Tag der Befreiung des KZ Auschwitz, als Klagetage; sie sind auch Körpern eingeschrieben über Namengebungen, Bildungsprozesse, Moden.
In Deutschland spielt der Umgang mit Relikten der nationalsozialistischen Vergangenheit eine wichtige Rolle. Das betrifft die materielle Hinterlassenschaft, aber auch die Frage eines angemessenen Gedenkens an die Nazi-Verbrechen, die zu einem identitätsstiftenden Teil des eigenen Geschichtsbildes geworden sind. Dazu gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, der nur am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums in Frage gestellt wird. Komplexe wie das gigantische Aufmarschgelände des „Reichsparteitages“ der NSDAP in Nürnberg können kaum zerstört und damit aus dem Gedächtnis getilgt werden. Heute sind sie Orte höchst eindrücklicher musealer Inszenierungen, sie sind Lernorte für die Demokratie geworden (https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/). Zu erinnern ist auch an die Berliner Gedenkorte für die Opfer des nationalsozialistischen Terrors. In intensiven öffentlichen Debatten um die Gestaltung der Denkmäler wurde um Formensprache und Symbolik gerungen. Die nach Plänen des preußischen Baumeisters Schinkel erbaute, am Prachtboulevard „Unter den Linden“ gelegene „Neue Wache“ ist heute „Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“. Zu Beginn der 1990er Jahre hatte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl angeregt, im Innenraum der Gedenkstätte die Bronzeplastik „Mutter mit totem Sohn“ der pazifistischen Bildhauerin Käthe Kollwitz aufzustellen. Für heftige Kritik sorgte damals, dass die Formensprache der Plastik deutlich auf die christliche Ikonographie der Pietá, als der Trauer Mariens um ihren toten Sohn Jesus, Bezug nimmt. Man sah darin eine unzulässige Vereinnahmung der jüdischen und kommunistischen Opfer des Nationalsozialismus. Interessant an diesem Gedenkort sind seine mehrfachen Überschreibungen und die damit verbundenen Neuinterpretationen: Ursprünglich im Jahr 1818 als eine preußische Gedenkstätte an die „Befreiungskriege“ konzipiert wurde 1931 ein betont schlichter Innenraum zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkrieges gestaltet, der alsbald von den Nationalsozialisten in Dienst genommen und nach der Kriegszerstörung im Jahr 1960 von der DDR zum „Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus“ umgewidmet wurde – übrigens unter Entfernung des Kreuzes als eines christlichen Symbols.
Nur wenige hundert Meter entfernt von der Neuen Wache findet sich das 2005 eröffnete „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ mit seinem von Peter Eisenman konzipierten monumentalen Feld von 2711 Betonstelen, in seiner betonten, jede sinnhafte Integration verweigernden Bildlosigkeit ein exakter Gegenentwurf zu der zur emotionalen Identifikation einladenden Pietá der Neuen Wache. Auch dieser Gedenkort wird erschlossen durch einen „Ort der Information“. Dort werden Seminare und Führungen angeboten, die etwa von Gruppen, Schulklassen, Universitätsseminaren in Anspruch genommen werden.
Bei allen Auseinandersetzungen um ihre Gestaltung drücken diese Denkmäler aber doch einen denkbar breiten gesellschaftlichen Konsens im Blick auf die Erinnerungspolitik aus: „Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz“ ist der fundamentale Wertekonsens der deutschen Politik. Das unterscheidet diese Denkmäler von der umstrittenen Skulptur etwa oder von den Auseinandersetzungen um die Bedeutung der Konföderierten-Flagge in den Südstaaten der USA.
Noch ein anderer Gedenkort sei hier betrachtet, für den ein solcher Konsens nicht besteht: Es geht um die Garnisonskirche in Potsdam, der nahe bei Berlin gelegenen Residenzstadt der preußischen Könige mit ihren Schlössern und Parks. Die Garnisonskirche war am 21. März 1933, dem „Tag von Potsdam“, Schauplatz einer demonstrativen Verständigung der alten preußischen Eliten mit Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus. Die Kirche wurde 1945 schwer beschädigt, ihre Ruinen im Jahr 1968 von den DDR-Machthabern in einem ebenso demonstrativen Akt gesprengt. Der Wiederaufbau zunächst des Turmes soll im Zeichen einer Rekonstruktion des historischen Baubestandes der Potsdamer Innenstadt erfolgen, ist allerdings bis heute höchst umstritten. Die Evangelische Kirche in Deutschland und ein von vielen prominenten Persönlichkeiten unterstützter Verein streben den Wiederaufbau als eine Lernstätte für den Frieden an und haben in einem Behelfsbau eine Versöhnungskapelle und ein Bildungszentrum errichtet. Lautstarke Kritiker, zu denen auch kritische kirchliche Gruppen gehören, sehen im Wiederaufbau vor allem eine Rehabilitation der alten militaristischen Koalition von Thron und Altar. Ähnliche Kontroversen entzünden sich auch an der Wiedererrichtung des Berliner Stadtschlosses der preußischen Könige. Das Schloss war ebenfalls gesprengt worden, wurde dann mit dem Parlament der DDR, dem „Palast der Republik“ überbaut, der seinerseits abgerissen wurde, um nun das Schloss zwar mit neuem Innenleben als „Humboldt-Forum“, aber mit seiner historischen Fassade aufzubauen. Für Kontroversen sorgen die Übernahmen christlicher Symbolik: das Kreuz auf der Schlosskuppel und ein umlaufender Bibelspruch aus Philipper 2,10: „Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind“. Ist dies nur eine historische Rekonstruktion oder ein aktueller Machtanspruch einer gründlich desavouierten christlich verbrämten Herrschaftsideologie?
Bislang fraglos geltende Traditionen werden plötzlich als konfliktverschärfend erlebt.Diese beständigen Überschreibungen und Re-Interpretationen einer als Last empfundenen Geschichte zeigen die komplexen Verständigungsprozesse einer pluralistischen Gesellschaft, in die auch die Kirchen einbezogen sind. Die Konflikte zeugen mehr noch als ein oft mühevoll erreichter Konsens für die Funktionsfähigkeit der demokratischen Ordnung, als der politischen Lebensform der Freiheit. Das Gemeinwesen und die es tragende demokratische Gesellschaft lebt bei allem Konflikt von einer geteilten politischen Öffentlichkeit und einer gemeinsamen Sprache, in der überhaupt gestritten werden kann. Die politische Öffentlichkeit ist allerdings fragil, sie muss sich im Konflikt und in der Debatte immer wieder neu herausbilden.

Mit steigender interner Komplexität und Diversität der Gesellschaft wird diese Aufgabe nicht leichter. Idealtypisch betrachtet liegen zwei Versuchungen nahe: Bislang fraglos geltende Traditionen werden plötzlich als konfliktverschärfend erlebt. Aus dem christlichen St. Martinsfest wird etwa ein religionsneutrales Lichterfest, aus dem Weihnachtsmarkt ein „Knuspermarkt“. Traditionen werden immer weiter verdünnt, bis sie keinen Anstoß mehr erregen. Die andere Möglichkeit: Man kann die Identitätsmarker stabilisieren, auf mehr oder weniger harte kulturelle und politische Grenzziehungen setzen.
Die „sozialen Netzwerke“ sind effektive Mittel, homogene Teilöffentlichkeiten zu mobilisieren, …Beide Strategien, die Neutralisierung kultureller Überlieferungen sowohl wie ihre Verabsolutierung, führen in die Irre, steigern gesellschaftliche Spaltung und schließen die jeweils anderen Positionen aus Verständigungsprozessen aus. Diese Verständigungsprozesse haben sich durch die digitalen Medien und ihre besondere Form der Öffentlichkeit verändert, sie sind gleichzeitig leichter und schwieriger geworden. Es ist einerseits leichter geworden, Meinungen und Informationen zu teilen und darüber auch große Zahlen von Menschen zu mobilisieren. Es ist aber andererseits schwieriger geworden, Debatten zu führen, die über den Austausch von Argumenten funktionieren, über respektvolles Zuhören und Abwägen. Die „sozialen Netzwerke“ sind effektive Mittel, homogene Teilöffentlichkeiten zu mobilisieren, die sich nur noch auf kleine Ausschnitte einer vorformatierten Wirklichkeit beziehen. Damit geht ein Empörungsgestus Hand in Hand, der als progressiver Shitstorm („Cancel Culture“) ebenso erscheinen kann wie als abseitige Verschwörungstheorie.
Darin zeigt sich eine zweite Debattenlinie: Es geht nicht nur um den Gegensatz von antirassistischem Protest und populistischem Backlash. Innerhalb des progressiven Lagers ist umstritten, wie Rassismus und Diskriminierungserfahrungen verstanden und effektiv überwunden werden können. Geht es um Identifikationen benachteiligter Gruppen, um Machtverhältnisse, die bestimmten Gruppen den Zugang in die Arena der politischen Öffentlichkeit von vornherein versperren? In der Fluchtlinie dieser Position sind dann auch kollektive Identitäten in Form von Gruppenzugehörigkeiten wichtig – und damit der Streit um Sichtbarkeit, Würde und Anerkennung dieser Zugehörigkeiten, wie sie etwa in den Diskussionen um „cultural appropriation“ zum Thema werden. Dagegen steht dann ein liberaler Universalismus, der von der Beobachtung ausgeht, dass die Betonung von Gruppenzugehörigkeiten die Unterscheidungen geradezu vertieft, die sie zu überwinden anstrebt.
Eine messianische Ethik der Präsenz
Nun die Frage: Welche heilsamen Ressourcen können von Kirchen und christlichen Gemeinschaften in diese unaufgelösten Spannungen zwischen antirassistischen Protest, universalistischer Ethik und populistischer Gegenrevolution eingebracht werden? Ich möchte auf diese Frage eine erste allgemeinere und grundlegende Antwort geben und in einem zweiten Schritt auf die konkrete Rolle der Kirchen in Deutschland eingehen.
Als eine erste heilsame Ressource denke ich an eine messianische Ethik der Gewaltlosigkeit, wie sie etwa in den Heilungsgeschichten der Evangelien begegnet. Dies meint im Kern nicht einfach ein ethisches Konzept, sondern vielmehr eine historisch wirksame Praxis, die aus einer Jahrhunderte währenden beständigen Re-Lecture dieser ikonischen Kerngeschichten des Evangeliums herauswächst, sich auch in die gesellschaftlichen Ordnungen und politischen Institutionen inkorporiert und damit zu einem wesentlichen Element auch neuzeitlicher Freiheitsgeschichte geworden ist. In der Mitte dieser Narrationen steht die Proklamation „Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen“ (Markus 1,15 par). Diese Proklamation bewahrheitet sich in der Autorität Jesu gegenüber den zerstörerischen Mächten der Krankheit, des Todes, der Dämonen, in denen sich die Destruktivität einer gefallenen Welt verdichtet. Pointe der Heilungserzählungen und Dämonenaustreibungen ist die geduldige Macht der Inklusion, mit der Jesus verwundete Menschen zurückholt in die Gemeinschaft des Gottesvolkes. Diese Inklusion beginnt mit einer Ethik der Präsenz. Ihr Inbegriff ist das Sehen, Hören und Berühren. Ich nehme nur exemplarisch die Erzählung von der Heilung des blinden Bartimäus in Markus 10,46-52. Diese Heilung hat einen konkreten Ort, Jericho. Der Blinde hat einen Namen, er ist konkrete gegenwärtige Person. Die Heilung hat die eine, bestimmte Zeit der Begegnung. Sie hat die leibhafte Dimension des Hörens: Der Blinde schreit seine Not heraus. Jesus hört ihn, ruft ihn, steht ihm gegenüber. Sie ist verkörpert, es geht in ihr um leibhafte Wiederherstellung, um Sehendwerden - im durchaus auch symbolisch codierten Sinn des Wortes. Und sie mündet in Nachfolge, einem Mit-Jesus-Gehen, in einem Ortswechsel, sie mündet in Dynamik.
Die Kirchen können gerade durch ihre geschichtliche Verankerung, ihren langen historischen Atem, eine Alternative zur toxischen Mischung von Empörung und Polarisierung setzen.Diese und andere Erzählungen der Evangelien sind Ressourcen, indem sie Perspektivwechsel anbieten. In den Kirchen und christliche Gemeinschaften wirkt die messianische Ethik der Präsenz, dort, wo leibhafte Gemeinschaften von Christen mit und aus dem Evangelium, aus der heilsamen Präsenz des Gekreuzigten und auferstandenen Christus leben. Im Maße, wie dies geschieht, werden die Kirchen genau dies sein – Orte starker Präsenz der heilenden und inkludierenden Kraft Jesu. Damit ist auch die Rolle der Kirchen und christlichen Gemeinschaften im gesellschaftlichen Ganzen umrissen. Klar ist, dass dem Evangelium eine unveräußerliche universalistische Grundhaltung eingeschrieben ist, die mit Rassismus, Diskriminierung und gruppenbezogenen Abwertungen auf gar keine Weise zu vereinbaren ist. „Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott.“ (Röm 2,11) Allerdings gilt auch das andere, dass die Kirchen ihrer Ortsgebundenheit nicht werden entfliehen können. Sie sind Teil der Gesellschaften, in denen sie leben und damit gebunden an bestimmte soziale Kontexte und Konstellationen, so wie Bartimäus seinen Ort in Jericho hatte. Die Christen sind nicht nur, wie Stanley Hauerwas so prägnant formulierte, „resident aliens“, oder „Paröken“ (etwa 1. Petr 2,11). In der Mitte der alten Städte Europas stehen Rathaus und Kirche nebeneinander, in einem spannungsvollen Verhältnis von „Macht und Gnade“ (Reinhold Schneider). Das heißt auch, dass die liberale Ordnung, an individuellen Rechten und Lebenschancen orientiert, eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung ist für eine civitas, ein politisches Gemeinwesen von Freien und Gleichen. Die liberale Ordnung bedarf der sozialen Verankerung, die nur durch die vielfältigen Akteure der Zivilgesellschaft gelingen kann. Genau hier ist der Ort der Kirchen, als einer Interpretations- und Handlungsgemeinschaft. Obwohl nur ein Akteur unter anderen, kommt den Kirchen doch eine besondere Bedeutung zu, sie sind wesentlicher Anker der liberalen Ordnung, indem sie für die fundamentale Bedeutung der Menschenwürde eintreten. Die Kirchen können gerade durch ihre geschichtliche Verankerung, ihren langen historischen Atem, eine Alternative zur toxischen Mischung von Empörung und Polarisierung setzen.
In den gegenwärtigen Auseinandersetzungen können die Kirchen auch Lernorte der Demokratie sein, in denen sich sehr unterschiedliche soziale Gruppen und Meinungen begegnen – und der Raum für die Begegnung und den Austausch offen gehalten wird. Wie wenige andere Akteure der Gesellschaft sind die Kirchen in der Fläche verankert, in Dörfern und Städten, in unterschiedlichsten sozialen Gruppen. Trotzdem ist es nicht einfach so, dass die Christen über ein privilegiertes Wissen verfügen, wie das Gemeinwohl auszusehen habe. Sie haben in ihrem kulturellen Gedächtnis gewichtige Ressourcen für die demokratische Gemeinschaft, sie haben Praktiken der Gelassenheit: das Hören auf die Schrift, das Gebet, diakonische Zuwendung. Glaube als eine die vorfindliche Welt übersteigende Beziehung zu dem lebendigen Gott ist keine Lizenz für den Besitz einer alleinseligmachenden Wahrheit, wie manche religionskritische Liberale fürchten. Ganz im Gegenteil lehrt das Evangelium, die Verwechselung der eigenen Position mit dem Gottesstandpunkt zu überwinden – das ist der Kern des Ersten Gebots. Dieser Einsicht entspricht eine fröhliche und gelassene Zuversicht und Treue zu der Berufung, Friedensstifter zu sein, ihr entspricht aber auch eine Kultur des Austauschs und der Konfliktfähigkeit.
In der politischen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland sind die Kirchen durch langes Herkommen tief verwurzelt. Man spricht von einer Kooperationsordnung zwischen Staat und Kirche, von einer „hinkenden Trennung“, in der der säkulare Staat auf der Basis der Religionsfreiheit im Interesse einer gemeinsamen Gestaltung des sozialen Lebens die „res mixtae“ wie Schulunterricht, Feiertagsschutz, Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Militär, Gefängnissen im Einvernehmen mit den Kirchen fördert. Diese Kooperationsordnung erwächst auch aus der Einsicht, dass das Gemeinwesen der Verankerung in der kulturellen Tradition bedarf, in einer konkreten Geschichte, die nicht einfach neu geschrieben werden kann. Bei aller Erosion der individuellen Frömmigkeit und sinkenden Zahlen der Kirchenmitgliedschaft scheint der „Bedarf“ an „öffentlicher Religion“ eher zu steigen. Das ist zwar ein ambivalenter Befund, könnte er doch bedeuten, dass die christliche Tradition wieder ein Legitimationsbedürfnis erfüllen würde, markiert aber doch auch, dass die unabweisbare Frage nach Heil und Rettung nicht politisch beantwortet werden kann, wenn denn Politik nicht unter der Hand zur Ideologie werden darf. Die Kirchen sollten so auch künftig durchaus offensiv die „kulturelle Prägekraft“ ihrer Botschaft ernst nehmen. Das Kreuz hat grundsätzlich seinen Raum in der Öffentlichkeit und auf den Sonntag oder Weihnachten und Ostern wird niemand verzichten wollen. Ist das eine kulturelle Dominanz? Vielleicht, aber worin läge die Alternative? Einschreibungen auf Orte und Zeiten sind nur schwer zu vervielfältigen.
Freilich hängt die Legitimität eines derartigen Arrangements davon ab, dass die Stimme der Ausgeschlossenen und der Opfer zu Gehör kommt. Genau darum geht es in den gegenwärtigen Protestbewegungen um koloniale, rassistische oder geschlechtsspezifische Diskriminierungen. Der in Princeton lehrende Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller zitiert den Philosophen Tom McCarthy: „Die Opfer müssen das erste Wort haben; das bedeutet nicht, dass ihnen auch das letzte Wort zukommt.“ In den politischen Raum übersetzt heißt das: Zuhören, Anerkennung, Präsenz und eine praktische Gestaltung der staatlichen Institutionen, die Teilhabe ermöglichen. Der Münchner Soziologe Armin Nassehi spricht von einer „neuen Grammatik der Wahrnehmung“, die nötig sei, damit nicht die ganze Welt nur „in Form der Diskriminierung erlebt werden muss“, entlang der Unterscheidung von partikularer Diskriminierungserfahrung und universalistischem Moralanspruch. Wie wird das möglich angesichts von Kommunikationsabbrüchen? Nassehi ermutigt dazu, andere „Unterscheidungen“ zu erkunden und in gemeinsamer Praxis zu erproben. Ich stelle mir vor, dass die Kirchen, im Sinne einer messianischen Ethik der Präsenz, solche Orte einer inkludierenden Praxis sein können. Zumindest kenne ich Gemeinden und Gemeinschaften, die sich durch die apostolischen geistlichen Kernpraktiken prägen lassen und zu solchen Orten der Inklusion werden: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“ (Apg 2,42)
Kehren wir noch einmal zu Moses Pölking und „Onkel Toms Hütte“ zurück. Moses Pölking ist in Berlin durch das Stadtviertel gegangen, in dem der U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ liegt. Er hat sich mit den Nachbarn unterhalten, die in der „Onkel-Tom-Straße“ wohnen, er hat zugehört und festgestellt, dass viele von ihnen nur ungern auf den gewohnten Namen und die damit verbundenen Erinnerungen verzichten würden – die ursprünglich auf den Wirt eines beliebten Lokals zurückgehen, der mit Vornamen Thomas hieß. Moses Pölking hat aber auch seine Sicht und seine Empfindungen erläutert und deutlich gemacht, dass die Zeit des Rassismus aus „Onkel Toms Hütte“ abgelaufen ist. Dieses Denkmal ist nun nicht von seinem Sockel gestürzt worden, andere schon, weitere werden zu Recht folgen. Aber die Berliner Erfahrung leuchtet ein: Reden, Zuhören, Streiten – so kann es auch gehen.
Dr. Roger Mielke, Militärdekan, unterrichtet Ethik am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr und an der Universität Koblenz. Bruder der Evangelischen Michaelsbruderschaft.