Subtotal: $
Checkout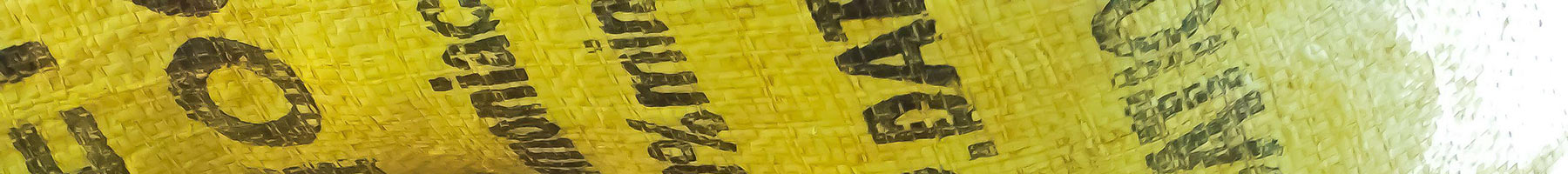
Okellos Geschichte
Wie der Mut eines Waisenkindes mein Leben gerettet hat.
von Simeon Wiehler
Mittwoch, 8. Januar 2025
Verfügbare Sprachen: English
Im Jahre 1983, als er neunzehn Jahre alt war, reiste Simeon Wiehler nach Uganda, wo die Diktatur Idi Amins in den 1970er Jahren viele Kinder zu Waisen gemacht und ihrer Heimat beraubt hatte. Er begann, in Waisenhäusern zu arbeiten, und gründete schließlich sein eigenes Waisenhaus - der Ort, an dem sich die folgende Geschichte ereignete. 1996 kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück, um an der Cornell University ein Promotionsstudium in Soziologie aufzunehmen. Simeon ließ sich 2009 mit seiner Frau Clementine, die den Völkermord überlebt hatte, und ihren drei gemeinsamen Söhnen Peter, Joshua und Gideon in Ruanda nieder. Er starb am 10. Juni 2024 im Alter von 62 Jahren an Krebs.
Wir hatten diesen Mais wirklich nicht gestohlen. Ganz sicher nicht. Ich meine, wir hatten ihn völlig legal gekauft: zwei Säcke geschälten weißen Mais, oben im Dorf Geregere. Wir hatten auch lange und hart über den Preis gestritten und uns schließlich auf etwas Vernünftiges geeinigt, das Geld wurde von Hand zu Hand weitergegeben und rundum war ein Lächeln auf den Gesichtern.
Und natürlich mussten wir ihn noch irgendwo mahlen lassen. Man kann ja nicht einfach getrockneten Mais essen.
Er muss zu feinem, weißem Mehl gemahlen werden, bevor er gekocht und zu Posho verarbeitet werden kann.
Da fiel mir die Hammermühle in Kayanja ein. Ich wusste nämlich, dass in Lugazi der Strom abgestellt war, und zwar schon seit mehreren Tagen, was hin und wieder vorkommt, so dass die Mühle dort nicht laufen würde.
„Aber“, höre ich dich schon sagen, „du hättest doch abwarten können, bis sie es reparieren.“ Und das ist wahr, nur sind die Dinge in Uganda nicht immer so einfach. Ich meine, aus morgen und übermorgen wird schnell eine Woche, und man kann nicht ewig von Dodo leben - das ist wilder Amaranth, der gekocht etwa wie Spinat schmeckt. Ich konnte Spinat ohnehin noch nie leiden, und irgendwer muss irgendwo einfach auch mal eine Grenze ziehen.
Außerdem kannte ich viele Leute in Kayanja. Zugegeben, ich kannte nicht jeden, aber mich, mich kannten sie alle. Andererseits will das nicht viel heißen – als einziger Weißer im ganzen Bezirk fiel ich sowieso auf wie ein Kamel auf einer Kuhweide. Das kann manchmal ein Vorteil sein, aber es kann auch peinlich sein. Zum Beispiel, wenn ich jemandem in Kampala oder Entebbe begegne: Er klopft mir auf die Schulter, schüttelt wild meine Hand und erzählt mir von seiner Frau und den Kindern, wie er morgens drei seiner Ziegen tot aufgefunden hat, dass die Bananenplantage dieses Jahr gut läuft, aber das Leben bei einem Kaffeepreis von nur sechzig Schilling pro Kilo sehr schwierig geworden ist. Und die ganze Zeit versuchte ich verzweifelt, in den hintersten Winkeln meines Gedächtnisses herauszufinden, wer das wohl sein könnte und wo ich ihm schon einmal begegnet bin. Es kann wirklich peinlich sein. Außerdem geht es ganz schön auf die Handgelenke.
Und so machten wir uns auf den Weg, sechs Kinder und ich, um mit unserem Mais nach Kayanja zu fahren. Vielleicht hätten wir bis zum nächsten Tag warten sollen – die Sonne stand schon tief über dem Berggipfel und wir hatten höchstens noch eine Stunde Tageslicht. Im Nachhinein kann man das natürlich leicht sagen. In diesem Moment dachte ich nur: Da stehen wir jetzt mit unseren zwei Säcken weißem Mais, der gemahlen werden muss. Und wie gesagt – ich mag nun mal keinen Spinat, und irgendwann reicht es einfach.

Foto von Tracy Angus-Hammond / Alamy Stock Photo.
Also fuhren wir los und sangen ugandische Lieder in vier Sprachen, während wir gegen die Türen und das Dach prallten, wenn der alte Land Rover auf ein Schlagloch traf, das größer als gewöhnlich war. Stellen Sie sich den Lärm vor: die vier Baganda-Jungen singen aus voller Kehle, Mwesige und Akiiki fügen ihren Teil in lautem Rutooro hinzu, während Okello etwas schief in der unverwechselbaren Sprache der Acholi mit einfällt.
Immer, wenn Okello einen besonders schiefen Ton von sich gab, versetzte ihm einer der Jungen einen Rippenstoß. Ja, er war ganz eindeutig der Letzte in der Rangordnung: dünn wie ein frisch gerupftes Huhn, durch und durch ein Einzelgänger, und Meister einer Sprache, die außer ihm niemand verstehen konnte. Noch schlimmer für ihn war, dass er aus dem Norden kam, ein Angehöriger des Acholi-Volkes, das in den gefürchteten Anyanya-Einheiten der Armee vorherrschte. In unserem Kinderheim wurde er zwar geduldet, aber Freunde fand er keine – so war das Leben für Okello. So fuhren wir der sinkenden Sonne entgegen und sangen aus voller Kehle, während wir über die Schlaglöcher rumpelten.
Als wir Kayanja erreichten, fuhren wir direkt zum Marktplatz, wo die Mühle stand. Sie war verschlossen, also schickte ich alle Jungs los, um den Besitzer, Herrn Kasozi, zu suchen. Nach einiger Zeit fanden sie ihn und brachten ihn zur Mühle hinüber. Er öffnete die schwere Tür und setzte das Mahlwerk in Gang, während wir die Maissäcke hineintrugen und das Korn behutsam in den großen Trichter rieseln ließen, während wir aufmerksam nach Steinen Ausschau hielten. Die große Hammermühle donnerte und bebte, weiße Staubwolken wirbelten durch die Luft, und langsam, unendlich langsam sickerte unser reines, weißes Maismehl aus der Rinne am anderen Ende der Maschine. Unser eigenes Mehl, weiß und frisch und sauber – es war eine Augenweide!
An den Türpfosten gelehnt, das dröhnende Stampfen der großen Maschine im Rücken, ließ ich meinen Blick über den sich rasch verdunkelnden Marktplatz schweifen. Geschäftstüchtige Standbetreiber zündeten kleine Kerzen vor ihren sorgfältig arrangierten Reihen von Tomaten und Ananas an. Andere platzierten Petroleumlampen neben den Waagen, wo eilige Kunden noch schnell getrockneten Fisch, rote Kidneybohnen oder große Fleischstücke abwogen. Nach und nach verwandelte sich der ganze Marktplatz in ein funkelndes Meer von winzigen Lichtern. Und als sich die Dämmerung vertiefte, schob sich ein orangefarbener Mond über die Hügel und verlieh der ganzen Szenerie eine atemberaubende Schönheit.
Endlich verstummte die Mühle hinter mir. Unser Mais war gemahlen, unser Tageswerk vollbracht. Ich warf einen letzten Blick auf den Marktplatz. In der plötzlichen Stille konnte ich das Zirpen der Grillen hören und leise Gesprächsfetzen der Dorfbewohner bei ihren letzten Besorgungen.
Mit einem ohrenbetäubenden KNALL explodierte die Stille – direkt neben meinem Kopf.
Ich fuhr vor Schreck zusammen und blickte im nächsten Moment direkt in das wutverzerrte Gesicht eines Soldaten, der sein Maschinengewehr auf meinen Bauch gerichtet hatte.
„Du bist ein Dieb“, fuhr er mich an. „Wer nachts Mais mahlt, der ist ein Dieb.“
„O-oh n-nein, Sir!“ Stammelnd versuchte ich, einen klaren Gedanken zu fassen. „Den Mais haben wir heute erst in Geregere gekauft!“
„Ein Dieb ist immer auch ein Lügner.“
„Bitte, Sir, ich … ich sage die Wahrheit.“
Plötzlich hatte ich eine rettende Idee: „Fragen Sie doch Herrn Kasozi! Die Mühle gehört ihm und er kennt mich schon seit langem. Ich bin mit ihm befreundet.“
Ich drehte meinen Kopf und rief: „Herr Kasozi?“ Keine Antwort. „Herr Kasozi?“ Absolute Stille.
Verzweifelt kämpfte ich gegen die aufsteigende Panik an. Offensichtlich hatte sich mein Freund aus dem Staub gemacht, als der Schuss fiel.
„Aber jeder in Kayanja kennt mich.“ Ich schaute mich verzweifelt auf dem Marktplatz um – er war wie ausgestorben. Ein paar vergessene Kerzen flackerten noch in der Dunkelheit, zurückgelassen von den Händlern und Dorfbewohnern, die in wilder Hast geflohen waren.
Der Soldat schnaubte verächtlich. „Die zwei Säcke Maismehl nehmen wir mit in die Kaserne – und Sie werden uns noch Rede und Antwort stehen“, sagte er drohend.
Nach all den Jahren in Uganda wusste ich: Was einmal in einer Kaserne verschwunden war, würde nie wieder zum Vorschein kommen. Weder Kühe noch Ziegen, oft nicht einmal Menschen – und ganz bestimmt keine Säcke mit frisch gemahlenem Maismehl. Der Gedanke, dass die Soldaten uns unser Abendessen stehlen und aufessen würden, war mehr als ich ertragen konnte. Ohne nachzudenken platzte es aus mir heraus – und trotz meiner zitternden Beine brachte ich die Worte laut und bestimmt über die Lippen.
„NEIN.“
Dem Soldaten quollen die Augen förmlich aus dem Kopf. In Uganda sagt niemand Nein zu einem Soldaten. Sicher nicht damals. Nie. Absolute niemals. Vielleicht hätte ich ihm das Mehl einfach geben sollen. Natürlich lohnt es sich nicht, für zwei Säcke Mehl sein Leben zu riskieren, aber tief in mir regte sich dieser unbezähmbare Dickschädel, und ich wollte einfach nicht wieder nur Dodo zum Abendessen haben. Ich konnte Spinat ohnehin noch nie leiden, und irgendwer muss irgendwo einfach auch mal eine Grenze ziehen.
Ein metallisches Klicken riss mich aus meinen Gedanken, als der Soldat mit einer schnellen Bewegung seines Daumens seine Waffe entsicherte und mich mit hasserfüllten Augen anstarrte.
Da stand ich, dem Tod direkt ins Auge blickend und von einer Angst erfüllt wie nie zuvor in meinem Leben, als ich plötzlich eine Kinderstimme neben mir hörte. Ich verstand kein Wort, aber die Stimme erkannte ich sofort: Es war Okello, und er sprach Acholi. Die Augen des Soldaten zuckten zwischen uns beiden hin und her. Ich konnte kaum atmen vor Anspannung, doch der Junge neben mir sprach in aller Ruhe weiter.
Bis heute verrät mir Okello nicht, was er an jenem Abend in Kayanja zu dem Soldaten gesagt hat. Er lächelt nur verlegen, so als wolle er mir zu verstehen geben, dass es Dinge gibt, die mich nichts angehen. Doch die Tatsache bleibt: Mit einem letzten hasserfüllten Blick spuckte der Soldat verächtlich in den Staub, drehte sich abrupt um und verließ den Marktplatz.
Langsam setzte ich mich auf einen der Mehlsäcke. Ich war völlig kraftlos; meine Beine zitterten so stark, dass ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte. Ich ließ den Kopf zwischen meine Knie sinken. Nach ein paar Minuten hob ich den Kopf und sah mich umringt von Dutzenden Menschen, die mich mit besorgten Blicken still beobachteten. In der Dunkelheit konnte ich kaum etwas erkennen, doch als ich lächelte, fingen plötzlich alle gleichzeitig an zu reden – was sie beobachtet hatten, wie alles geklungen hatte, wie mutig Okello gewesen war, und immer wieder, welches Glück ich hatte, noch am Leben zu sein. Natürlich war ich absolut derselben Meinung.
Auf dem holprigen Heimweg fiel mir etwas Merkwürdiges auf: Die Jungen hatten begonnen, Okello in ihre Unterhaltung einzubeziehen. Sie lächelten ihm zu und ließen ihn an ihren Witzen und ihrem Gelächter teilhaben. Sie lehnten sich zu ihm herüber und fragten nach seiner Meinung. Sie begegneten ihm mit dem Respekt, den ein so mutiger Junge verdient.
Beim Zuhören ließ ich die Ereignisse des Abends noch einmal Revue passieren. Warum Okello? In unserem lebhaften Alltag im Waisenhaus war er kaum zu bemerken – ein einsames Kind, mit dem ich mich anzufreunden versucht hatte, das aber kaum darauf eingegangen war. Was hatte ihm nur diesen unglaublichen Mut gegeben, sich einem bewaffneten Soldaten entgegenzustellen? Und warum ich? Was bedeutete ich ihm schon, dass er bereit war, sein Leben für mich aufs Spiel zu setzen – ich, ein weißhäutiger Ausländer, unerfahren und seiner Sprache nicht mächtig, zwar freundlich gesinnt, aber ständig dabei, sich zu blamieren?

Simeon im Kinderheim von Besaniya (Mukono), ca. 1984. Foto mit freundlicher Genehmigung der Familie Wiehler.
Tatsächlich bereitet uns das Leben kaum darauf vor, wenn Wunder geschehen. Unsere Sprache hat nicht einmal die Begriffe, um dieses Gefühl zu beschreiben: hart, stechend und brennend zwischen Herz und Magen, anschwellend in der Brust, eine glühende Stirn und ein Schauder, der durch den ganzen Körper fährt. Vielleicht haben sich die alten Propheten so gefühlt, als sie vor vielen Jahrhunderten zum ersten Mal diese leise, kleine Stimme vernahmen. In diesem Moment war es mir, als hörte ich ein Flüstern durch die Jahrhunderte zu mir dringen.
Was ich in jener Nacht auf dem Heimweg über die von Schlaglöchern durchzogene Straße miterlebte, war eine so vollständige Verwandlung, wie ich sie nie wieder gesehen habe. Das Ende von etwas Abgenutztem und Altem und der Anbruch von etwas völlig Neuem. Wie ein paar Worte in einer unverständlichen Sprache den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können. Und wie für einen Jungen diese mutigen Worte, ruhig und furchtlos ausgesprochen, zu einem solchen Neuanfang führen konnten.
Und in der Tat, es war ein Neuanfang für Okello. Von diesem Tag an war er mittendrin bei den Spielen und dem Gelächter der anderen Jungen. Er schloss Freundschaften, seine schulischen Leistungen verbesserten sich, und immer wieder widerlegte er die Pessimisten, die behaupteten, Nord- und Süduganda seien wie Öl und Wasser: zwei Völker, die zwar nebeneinander existieren, sich aber nie wirklich vereinen könnten.
Ja, ich stehe in doppelter Hinsicht in Okellos Schuld. Zum einen für die Worte, die er an jenem Abend in Kayanja sprach, zum anderen für den neuen Hoffnungsschimmer in einem von Hass und Misstrauen gezeichneten Land. Seitdem bin ich viele Male nach Kayanja zurückgekehrt, und jedes Mal, wenn ich angehalten habe, um mit den Händlern auf dem Markt zu sprechen oder Herrn Kasozi in seiner Mühle zu besuchen, hat sich eine Gruppe um mich versammelt, und bald wird die Geschichte erzählt, wie ich zu einem Anyanya-Soldaten „Nein“ gesagt habe.
Mit den Jahren hat sich die Geschichte ein wenig gewandelt, man könnte sagen, sie wurde hier und dort etwas ausgeschmückt. Als ich sie das letzte Mal gehört habe, soll ich einer ganzen Gruppe bewaffneter Soldaten die Faust entgegengestreckt und sie mitsamt ihren Waffen vom Marktplatz verjagt haben. Aber wir beide wissen, was an jenem Abend wirklich vorgefallen ist, und wir wissen auch, wer der wahre Held dieser Geschichte ist: Ein kleiner Junge, dünn wie ein frisch gerupftes Huhn, durch und durch ein Einzelgänger, und Meister einer Sprache, die außer ihm niemand verstehen konnte. Aber das Wichtigste ist, dass er aus dem Norden stammte, und dass sein Name Okello ist.
Ja, genauso war es. Als wir mit den Jungen und den beiden Säcken Maismehl zu Hause ankamen, bereiteten wir ein festliches Abendessen zu – Posho, frisch über dem offenen Feuer gekocht. Es war köstlich. Und ich habe mich nicht darüber beschwert, dass kein einziges Stück Dodo zu sehen war. Ihr wisst ja, ich konnte Spinat ohnehin noch nie leiden, und, na ja… irgendwer muss irgendwo einfach auch mal eine Grenze ziehen.
Simeon schrieb dieses Erlebnis 1996 in seinem ersten Semester an der Cornell University nieder. Veröffentlicht mit Genehmigung der Familie Wiehler.





