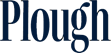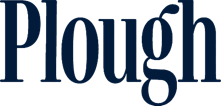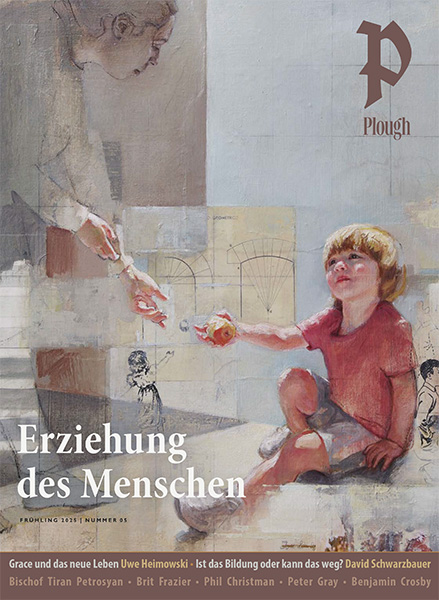Subtotal: $
Checkout-

Mathematik, die Schöne
-

Lernvergnügenstag
-

Rezension: Agonie des Eros
-

Rezension: Der Baron auf den Bäumen
-

Die anonyme Theologin
-

By Water
-

Früchte eines Buches
-

Schreinern mit Teens
-

Eisen schärft Eisen
-

Reden wir über Freiheit!
-

Wege der Versöhnung
-

Leserreaktionen
-

Nachtgebet
-

Wiedergeburt
-

Erziehung zur Freiheit
-

Einheit im Licht der Auferstehung
-

Dienst am Nächsten
-

Ist das Bildung oder kann das weg?
-

Grace und das neue Leben
-

Königin der Wissenschaften
-

Schule der fräsenden Philosophen
-

Forellen-Schule
-

Re-christianisierung in einer entchristianisierten Welt?
-

„Hey Respekt, hört auf den Lehrer!“

Sollte ich meinem Kind gruselige Märchen vorlesen?
Meinen Kindern ist längst bewusst, dass die Welt nicht sicher ist. Machen Drachen und Kobolde es nur noch schlimmer?
von Stephanie Ebert
Dienstag, 1. April 2025
„Und dann entdeckten die Häschen, dass in den Bergen ein Drache hauste, und –“
„Ein guter Drache“, unterbricht mich mein Fünfjähriger bei der Gutenachtgeschichte, die von einer Kaninchenfamilie und ihren Abenteuern handelt. „Der Drache ist gut. Kein böser Drache.“ Also gut, es ist ein freundlicher Drache, und ich erzähle weiter.
Als ich das Licht in seinem Zimmer ausknipse und die Alarmanlage aktiviere, wird mir bewusst, wie schnell ich nachgegeben habe. Ab welchem Alter dürfen Kinder in Geschichten mit Gefahren konfrontiert werden? Psychologen betonen seit Langem, dass Märchen für die kindliche Entwicklung wichtig sind. Ich glaube daran, dass Geschichten Kindern helfen können, Mut zu entwickeln. Und doch – jetzt, als Mutter, erkenne ich in den Augen meiner Kinder mein eigenes fünfjähriges Ich wieder und frage mich, ob ich das meinen Kindern wirklich antun soll. Wenn sie keine gruseligen Geschichten mögen, müssen wir sie dann mit Hexen, Kobolden und Drachen konfrontieren?
Ich wuchs als Kind evangelikaler Missionarseltern im Südafrika der 1990er Jahre auf, und meine Gutenachtgeschichten waren regelrecht furchteinflößend. Von Missionsbiografien über George MacDonalds Märchen – meine Fantasie war derart von beängstigenden Vorstellungen bevölkert, dass ich mich nachts kaum auf die Toilette traute.

Amy Bernays, Our Afternoon, Collage mit Kinderkunst, 2021. Alle Kunstwerke von Amy Bernays. Mit Genehmigung verwendet.
Natürlich lasen wir die Chroniken von Narnia, aber die Weiße Hexe erschien geradezu harmlos im Vergleich zum Zauberer aus David und Karen Mains' Trilogie Tales of the Kingdom. Diese Geschichten von tapferen Waldläufern, mutigen Kindern und einem König in Verkleidung, der eine Stadt erlöst, prägten mein Verständnis vom Reich Gottes tiefer und positiver als jede andere Buchreihe. Aber in meiner Fantasie lebte auch der feuerbesessene Zauberer, der zusammen mit den Brennern und Brechern die Stadt unterjochte – finstere Gestalten, die Kinder verschleppten und sie mit glühenden Eisen brandmarkten. Wenn ich aus solchen Albträumen hochschreckte, hämmerte mein Herz wie wild. Der Gang auf die Toilette wurde zur Qual, denn in der Dunkelheit glaubte ich überall die Brenner zu sehen, die nur darauf warteten, mich zu packen. In John Bibees Buchreihe Spirit Flyer kämpfen Kinder auf fliegenden Fahrrädern gegen einen finsteren Spielzeugmacher und Puppenspieler, der die Kinder der Stadt unterjochen will – sein Motto lautet: „Halte ihre Angst heiß und klebrig.“ Tagsüber sind solche Geschichten harmlos. Doch nachts, wenn alle anderen schlafen und man nur noch das Pochen des eigenen Herzens hört, zeigen sie ein anderes Gesicht. Die Angst ist dann wirklich heiß und klebrig.
Das waren unsere Märchen. Und dann gab es da noch die wahren Geschichten – Missionsbiografien voller Leiden um Jesu willen. Wir wussten, dass Jim Elliot mit einem Speer getötet wurde. Wir wussten, dass die Frau von William Carey verrückt wurde und starb. Wir wussten, dass das Christsein, vor allem als Missionar, bedeutet, dass Gott einen nicht vor allem beschützt. Verheißungen von der ewigen Gegenwart Christi im Leiden oder des „einen Tages“ im Himmel waren in meinem Denken weniger realistisch als die Enthauptung von John und Betty Stam.
Aus diesem Grund sind Geschichten von Drachen und Kobolden vielleicht ungefährlicher als Geschichten aus dem wahren Leben, aber als Mutter zögere ich trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinem Sohn Bilder von Brennern und Brechern in den Kopf setzen will, die auf dem Weg zur Toilette im Gang lauern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich seine Träume mit vermummten Gestalten mit glühenden Brandeisen, mit Zauberern und Trollen bevölkern möchte. Ich glaube meinem Sohn, wenn er mir sagt, dass er Angst hat. Diese Geschichten vermitteln christliche Tugenden, veranschaulichen spirituelle Wahrheiten und bewahren die Erinnerung an echte christlichen Helden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ausgerechnet ich es sein soll, die ihm diese heiße, klebrige Angst einflößen und ihn nachts mit Hexen und Gespenstern in seinem Bett gefangen halten soll. Ich weiß, was G. K. Chesterton sagen würde. Ich setze die Hexen nicht in die Köpfe meiner Kinder hinein; sie sind schon da: „Märchen geben dem Kind nicht seine erste Vorstellung vom Bösen … Das Kleinkind kennt den Drachen schon von Anfang an, allein schon durch seine Fantasie.“ Ich möchte gerne glauben, dass nicht ich für die Albträume meines Kindes verantwortlich bin – aber ich war selbst ein sehr empfindsames Kind, und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt.

Amy Bernays, The Wolf in His Ear, Collage mit Kinderkunst, 2021.
Natürlich kannte ich als Kind andere Geschichten, die mir viel mehr Angst machten als Drachen. In den 1990er Jahren war Südafrika zum Glück von der Apartheid befreit und vor einem drohenden Bürgerkrieg verschont geblieben, den alle befürchtet hatten. Aber es strömten Waffen in das Land, es herrschte extreme Ungleichheit, eine sich ausbreitende HIV/AIDS-Epidemie wütete, und die Gewaltkriminalität erreichte ihren Höhepunkt. Es waren keine Geschichten, die mir meine Eltern erzählt hatten, sondern von denen wir zwangsläufig erfuhren.
In der Schule überboten sich die Kinder mit dem, was sie von ihren Eltern bei den Braais (Grillabende) am Wochenende aufgeschnappt hatten. Menschen wurden an Ampeln mit vorgehaltener Waffe bedroht und gezwungen, aus ihren Autos auszusteigen. Meine Freundin wurde nachts wach und sah ein Gesicht, das durch einen Spalt zwischen den Vorhängen lugte; als sie aufschrie, jagte ihr Vater den Eindringling vom Grundstück. Von da an zog ich jeden Abend besonders gewissenhaft meine Vorhänge zu. Kinder erzählten sich Geschichten über Autoüberfälle, Einbrüche und Morde auf entlegenen Gehöften, während wir das Essen in unseren Brotdosen untereinander tauschten.
In gewisser Weise waren diese Geschichten noch sagenhafter als die imaginären Welten in meinen Büchern. Es waren Mythen im ursprünglichsten Sinne – Geschichten, die Erwachsene am Feuer erzählten, um unverständliche Reaktionen zu erklären und zu rechtfertigen. Sie wurden zu den Geschichten, die begründeten, warum diese Erwachsenen aus Südafrika wegziehen wollten. Sie gaben den latenten Ängsten Gestalt, die durch die vielen gesellschaftlichen Umbrüche entstanden waren. Sie alle enthielten ein Körnchen Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Heute, als Erwachsene im hellen Tageslicht, kann ich verstehen, dass die Realität sehr vielschichtig ist. Ich verstehe nun, dass für die Eltern einiger meiner weißen Freunde „Ich fühle mich nicht sicher“ nur eine andere Art war, zu sagen: „Ich traue den Schwarzen nicht.“ Aber als Kind, wenn ich die reißerischen Schlagzeilen sah, die am Schulweg an Laternenmasten prangten, war alles ganz eindeutig. Wenn Menschen aus meinem Umfeld Opfer von Gewaltverbrechen wurden, konnte es genauso gut auch mir passieren.
Meine Eltern durchschauten die reißerische Berichterstattung und unternahmen viel, um uns davon abzuschirmen. Und selbst in wirklich gefährlichen Situationen schonten sie uns. Als wir Anfang der Neunziger Jahre, noch vor dem Ende der Apartheid, Kleinkinder waren, bauten wir auf Mamas Vorschlag bei Gewitter manchmal eine Höhle aus Sofakissen im Flur. Wir spielten dieses Spiel bis in die Grundschule hinein, aber erst später erfuhren wir, dass die vermeintlichen Donnerschläge in Wirklichkeit Schüsse waren. Bei Tisch sprachen sie nicht über Entführungen oder Verbrechen. Sie hatten viele Freunde, die in benachteiligten Gegenden lebten, und kannten dadurch die wahren Gefahren, und waren zuversichtlich, dass wir vor dem Schlimmsten bewahrt bleiben würden. Sie waren überzeugt, dass die Verbrechen weniger nicht die wunderbare Erfahrung der Freiheit und Versöhnung zunichtemachen konnten, die die meisten Menschen in unserem Land in jener Zeit erfuhren. Sie verstanden, dass jegliche Gewalt in einem nun freien Land weit weniger wog, als die Gewalt unter der Apartheid-Regierung. Und trotzdem verriegelten wir die Türen, kurbelten Fenster an jeder Ampel hoch und versteckten unsere Taschen unter den Autositzen, damit sie nicht im Blick waren.
Und so ging es bei meinem nächtlichen Spießrutenlauf vom Schlafzimmer zum Badezimmer nicht nur darum, den unheimlichen Männern mit Bowlerhüten aus den Spirit-Flyer-Büchern oder den finsteren Brennern und Brechern zu entkommen. Da war dieses Fenster ohne Vorhang hoch oben im Bad, durch das jemand spähen könnte. Man hörte Schlurfen, das Knarren der Dielen, und die Holzdecke ächzte, während sie sich in der Hitze ausdehnte und zusammenzog. War da jemand im Wohnzimmer, der nur darauf wartete, dass ich aufstehen würde? Sollte ich so tun, als ob ich schliefe?
Die Welt ist durchdrungen vom Bösen, sichtbar wie unsichtbar, real wie imaginär. Es ist egal, wo man lebt. Und jene von uns, die eine lebhafte Vorstellungskraft besitzen, müssen wohl vorsichtiger abwägen, was wir an uns heranlassen. Mag sein, dass andere Kinder keinen Schaden nehmen und mutiger werden, wenn sie über Drachen lesen. Für mich waren die Drachen allerdings sehr real. Und wenn nun mein Kind keine gruseligen Märchen hören will, stelle ich mir die Frage, ob ausgerechnet ich es dazu zwingen soll?

Amy Bernays, Eurus the East, Collage mit Kinderkunst, 2021.
Mein Mann und ich leben in Südafrika, und obwohl es hier viel sicherer ist als in meiner Kindheit, erlebten wir im letzten Jahr mehrere Einbrüche in unser Haus. Mehrfach brachen Leute in unser Haus ein und nahmen Dinge mit – von Jacken über Laptops bis hin zu Essensresten. Unsere Fenster wurden mit Fingerabdruckpulver bestäubt, wieder und wieder kamen Polizeibeamte zu uns, manchmal um zwei Uhr nachts. Ich war schon fast an das Geräusch der Alarmanlagen und an die Lichtblitze mitten in der Nacht gewöhnt. Ich versuchte, an meine Eltern zu denken, die uns im Flur so gut es ging beschützten, und sich bemühten, unsere kindliche Naivität durch ein Spiel zu bewahren. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das in ein Spiel verwandeln sollte. Mein Sohn fing an, sein Sparschwein zu verstecken, bevor er morgens zur Schule ging.
Vielleicht hatte ich die Geschichten über die Weiße Hexe und ihre Wölfe, Drachen und Kobolde deshalb zurückgehalten, weil es das Einzige war, das ich noch kontrollieren konnte. Die gewalttätige Welt, die in seine Träume eindringt, kann ich nicht fernhalten; Einbrecher und reißerische Schlagzeilen lassen sich nicht abwenden, aber ich kann verhindern, dass Kobolde durch seinen Flur schleichen. Ich kann alle unsere Drachen zu guten Drachen machen.
Aber vielleicht sehe ich das alles falsch.
Vielleicht hat Chesterton recht. Vielleicht muss ich in einer Welt voller Diebe und Waffen, Drogen und Tod nicht warten, um ihm die Erfahrung von Angst durch Geschichten aus Büchern nahezubringen. Vielleicht sind die Geschichten weniger wegen des unheimlichen Zauberers beängstigend, sondern weil jene Angst, heiß und klebrig, mit der mein Sohn ohnehin schon jeden Tag lebt, sich auch in ihnen wiederfindet.
Und wenn mein Sohn die Angst erkennen kann, kann er vielleicht auch den Mut erkennen. Denn die Märchen enden nie in Finsternis. Schließlich können die magischen Fahrräder fliegen. Mit ihren Scheinwerfern leuchten sie durch die Finsternis und vernichten aschefressende Schlangen und böse Puppenspieler. Chesterton fährt fort: „Was Märchen dem Kind geben, ist seine erste klare Vorstellung von der möglichen Niederlage des Bösen … Was das Märchen für ihn bereithält, ist ein Sankt Georg, der den Drachen tötet.“
Vielleicht hatte ich vergessen, was mir überhaupt die Kraft gab, Nacht für Nacht trotz der lähmenden Angst in meiner Brust den Weg ins Bad zu finden. Denn obwohl der Flur von bösen Kreaturen bevölkert war, schaffte ich es doch irgendwie jede Nacht durchzukommen. Es war das Licht in eben diesen unheimlichen Geschichten, das mir dabei half. Bibelverse, die ich wie eine Beschwörung aufsagte, um meine inneren Ängste zu vertreiben: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?“ Das Wissen, dass Prinzessin Amanda in der Tales of the Kingdom-Reihe Drachen besiegt hat, so wie der König den Zauberer besiegt hat. Das Motto des Buches, „Sehende haben keine Angst“, sang ich immer wieder, wenn mir die Bibelverse ausgingen.
Vielleicht vergesse ich zu schnell, dass diese Geschichten voller Gefahren und Dunkelheit auch dazu beitragen können, Erinnerungen an das aufzubauen, was gut und stark ist. Vielleicht können meine Kinder – wie Digory und Polly mit ihrer Erinnerung an Aslan in Das Wunder von Narnia – so viel Gutes in einer Geschichte entdecken, dass sie behaupten können „dass, solange sie lebten, wenn sie jemals traurig oder ängstlich oder wütend waren, der Gedanke an all das goldene Gute und das Gefühl, dass es immer noch da war, ganz in der Nähe, gleich hinter irgendeiner Ecke oder hinter irgendeiner Tür, zurückkam und ihnen die Gewissheit gab, dass tief in ihrem Inneren alles in Ordnung war.“ Vielleicht sind die Waffen des Lichts, wie Peters Schwert und Susans Pfeile, und das Wissen, dass die ganze Macht Aslans immer in greifbarer Nähe ist, stark genug, um mein Kind auf seinem nächtlichen Weg vom Bad zurück ins Bett zu begleiten.
Nach der Einbruchsserie in unser Haus machte unsere Familie einen Campingausflug. Als ich an diesem Abend am Feuer saß, nahm ich meinen Mut zusammen und sagte zu meinem Sohn: „Wir werden jetzt eine meiner Lieblingsgeschichten lesen. Und sie macht ein bisschen Angst. Aber sie ist gut. Das verspreche ich dir. Du wirst Angst bekommen, aber am Ende wird alles gut werden.“
Es ist beängstigend, aber Gott ist gut. Am Ende wird alles gut werden. Ist das nicht der Kern unserer christlichen Hoffnung in einer Welt voller Übel – ob real oder imaginär? Ich schlug das Buch auf und begann: „Es waren einmal vier Kinder, die hießen Peter, Susan, Edmund und Lucy …“