Subtotal: $
Checkout-

Königin der Wissenschaften
-

Schule der fräsenden Philosophen
-

Forellen-Schule
-

Freiheit dem Wort
-

Re-christianisierung in einer entchristianisierten Welt?
-

„Hey Respekt, hört auf den Lehrer!“
-

Achtsamkeit dem Kinde
-

Spiel oder stirb
-

Sollte ich meinem Kind gruselige Märchen vorlesen?
-

Mathematik, die Schöne
-

Lernvergnügenstag
-

Die anonyme Theologin
-

Früchte eines Buches
-

Schreinern mit Teens
-

Eisen schärft Eisen
-

Leserreaktionen
-

Erziehung zur Freiheit
-

Dienst am Nächsten
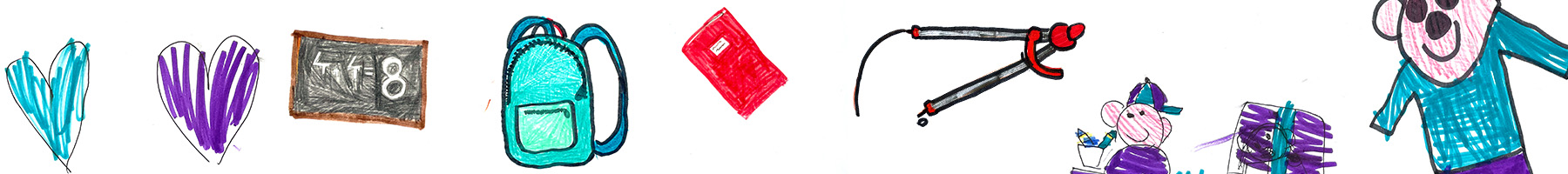
Ist das Bildung oder kann das weg?
Ein Abriss der Schullandschaft und der Versuch eines Wiederaufbaus.
von David Schwarzbauer
Dienstag, 1. April 2025
Nächster Artikel:
Entdecken Sie andere Artikel:
Tom wetzt auf einer viel zu metallenen Sitzbank rastlos hin und her. Seine Schuhe, die eher zu groß für seinen kleinen Körper ausgefallen sind, baumeln über dem feuchtkalten Boden der Straßenbahnhaltestelle, in der einen Hand hält er ein Smartphone, in der anderen einen zuckrigen Energydrink. Um ihn herum rauscht das Leben vorbei – hastig, laut, unbarmherzig. Niemand achtet auf ihn. Sein Kopf ist voller Tik Tok-, Twitch- und YouTube-Träume darüber, wer er sein könnte: SpontanaBlack, Alan Stokes oder doch Mr. Beast? Doch an jenem Donnerstagmorgen, während seine Klassenkollegen im nahegelegenen Plattenbau längst schon über die Sinnlosigkeit von Winkelfunktionen und Gesellschaftspyramiden lamentieren, krallen sich seine blutleeren Augen am Bildschirm fest, um doch vielleicht noch irgendetwas zu erheischen, was ihm Aufschluss darüber geben will, wer er eigentlich ist.
Und doch hat er keine Vorstellung davon, dass er mehr sein könnte, als sein digitales Profil. Charakter? Das klingt wie ein Relikt aus einer längst verblichenen Zeit, in der Werte noch mit dem Holzlineal nachgezogen wurden. Heute zählen Likes und Followers mehr als Prinzipien, und das Wort „Persönlichkeitsentwicklung“ findet sich bestenfalls auf dem Werbeflyer für teure Sommercamps in den Schweizer Alpen oder in der Reportage des letzten Falstaff Magazins über den Wein eines Boutique-Weinguts an den terrassierten Hängen von Girgenti auf Malta.

Zeichnungen von Theresa (11), Pio (9), Rosa (7) und Maria (6).
Wie kommt Tom dorthin – und mit ihm eine ganze Generation von Halbwüchsigen, die sich laut dem Psychologieprofessor Jonathan Haidt zuallererst mal durch Angst auszeichnet? Ein Blick auf die Geschichte des Schulwesens, den Begriff der Erziehung und einen radikalen Ansatz zur Weltveränderung soll dabei helfen, Tom zu verstehen und vielleicht auch die eine oder andere Anregung dazu geben, die Straßenbahnhaltestelle zu verlassen und das Leben wieder für sich zurückzugewinnen.
Die groteske Idee Schule
Die ältesten Spuren von dem, was wir heute als Schule bezeichnen, reichen bis weit vor die Geburt des Jahrtausendbabys aus Bethlehem zurück und führen in die Stadt Uruk in Mesopotamien, womit das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak bezeichnet wird. Dort hat man Vokabellisten und Schulaufsätze gefunden, die eine Existenz von sogenannten „Tafelhäusern“ bis ins Jahr 4.000 vor Christus vermuten lassen.
Alles, was dem Menschengeschlecht an A-Deklinationen, Schulskikursen und Abibällen in den Jahrtausenden davor schon nicht erspart geblieben war, ist jedoch historisch nicht belegt und kann somit nur mit einer recht unwissenschaftlichen Verschwommenheit und einer großen Portion Phantasie gedanklich „rekonstruiert“ werden. Ich stelle es mir so vor:
Der letzte Neandertaler ist gerade den Wetterkapriolen des Klimawandels der vergangenen Jahrzehnte zum Opfer gefallen, als der Homo Sapiens beschließt, die Weltherrschaft an sich zu reißen und sich ausgehend von Südafrika auf dem Globus auszubreiten. Er bemerkt schnell, dass er am besten vorankäme, wenn er innerhalb seiner Familien und Stämme gemeinsame Sache machen und sich sozial arrangieren würde. Während sich die Frauen um den Einkauf, die Bügelwäsche und den Couscous-Salat mit Putenstreifen und Rucola kümmern, sorgen die Männer für einen vollen Tiefkühler, neue Gin-Rezepturen und protzende Motoren, welche ihnen bei der Arbeit unter die Arme greifen würden. Und die Kinder – vorausgesetzt sie sind alt genug – werden von ihren Eltern und Verwandten in die Aufgaben des Alltags eingeführt: Simone muss zuhause Zwiebel hacken, während Simon im Nationalpark dem Mammut das Fell über die Ohren ziehen darf. (Zumindest fügt sich dieses Bild in meiner Phantasie so zusammen und daran ändern auch neuere Forschungen oder aktuelle Graphic Novels wie Ulli Lusts „Die Frau als Mensch“ (noch) wenig.)
„Soll Rudolfine mir auch beibringen, wie ich ein besserer Mensch werde?“
Doch Simone lernt in der Urform der „Knödelakademie“ (österr. für Hauswirtschaftliche Berufsfachschule) nicht nur wie man Speisen zubereiten und den Tisch zu decken hat, sondern auch, dass große Mädchen nicht weinen würden (nein, nicht einmal beim Zwiebelschneiden!), dass sie eine wichtige Rolle innerhalb der Familie zu spielen hätte und dass sie für mehr Wärme, Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen dürfe. Simon lernt dafür in der prähistorischen HTBLA (Höhere Technische Bundeslehranstalt) unter anderem, dass er die Schwächeren schützen solle und dass er für das Gute zu kämpfen und in Zukunft in allen Belangen für seine Familie zu sorgen habe. Simon und Simone lernen also neben ganz praktischen Dingen auch wie sie so richtig feine Homo Sapiensen (gibt es davon eigentlich einen Plural?) werden können – und zwar von ihren Eltern, Geschwistern, Verwandten und Sippenkollegen – klar, wozu sonst steckt man so lange Zeit unter derselben Höhlendecke?
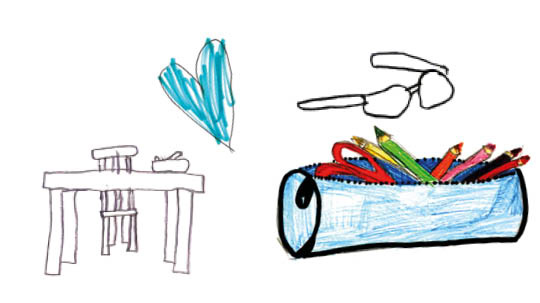
Und dann stelle ich mir vor, wie Simone eines Morgens überrascht von ihren Multigrain-Cheerios hochblickt, weil ihre Eltern eine verrückte Idee haben: Sie solle von nun an Dienstagvormittags zu Rudolphine am Ende des Dorfes gehen, um richtig kochen zu lernen. Die hätte nämlich keine Kinder und somit übermäßig viel Zeit und außerdem koche sie richtig leckereres Essen. „Soll Rudolfine mir auch beibringen, wie ich ein besserer Mensch werde?“, fragt Simone verdutzt. „Dafür bleibt die restliche Woche noch genügend Zeit“, winkt ihre Mum ab.
Die Idee, die nach wenigen Wochen ihre ersten kulinarischen Früchte trägt, spricht sich im Dorf herum und auch andere Familien folgen dem Beispiel von Simones Eltern. Alle möglichen Kinder werden zu allen möglichen Dorfbewohnern geschickt, um ihren Kindern alles Mögliche beizubringen, was sie selbst nur mittelmäßig draufhaben. Simon zum Beispiel geht für Französisch zum Austausch-Sapiens, von dem keiner weiß, wo er hergekommen ist und was es mit seinem komischen Akzent auf sich hat. Die Kinder im Dorf verbringen immer weniger Zeit zuhause, was den Eltern wiederum die Möglichkeit gibt, mehr Mammutfleisch aufzutreiben oder Tomaten anzubauen, womit die Nachhilfestunden wieder abgegolten werden können. Und von wem lernen die Kinder schließlich, wie sie bessere Menschen sein können? Dafür bliebe das restliche Leben noch genügend Zeit, sind sich die Dorfbewohner sicher! Und die groteske Idee der Schule ist geboren.
Und mit ihr beginnt sich das Verständnis für Erziehung und Bildung zu verändern. Was bis vor kurzem noch in den Zuständigkeitsbereich der Familie fiel und somit Menschen anvertraut war, die aus einer echten Fürsorge und Liebe heraus das Beste für ihren Nachwuchs wollten und alle Hebel in Bewegung setzten, damit diese auch das Beste bekamen (natürlich gab es auch hier Ausnahmen), wird immer häufiger ausgelagert und im besten Fall echten Mentoren und Meistern, im schlechtesten Fall jedoch Rudolphine oder dem Zufall überlassen. Der gute Hirte delegiert seine Aufgabe an den bezahlten Knecht, um in der Rhetorik der Bibel zu sprechen, und darüber, wie diese Geschichte ausgehen kann – vor allem dann, wenn der Wolf auftaucht – gibt das zehnte Kapitel des Johannesevangeliums genauer Aufschluss.
Erziehung und Bildung in verschiedenen Kulturen
Springen wir aus meiner Phantasiewelt und der Bibelmetaphorik jedoch wieder in die Realität zurück, um der Idee der Schule weiter auf den Grund zu gehen und um zu verstehen, wieso Tom immer noch an der Straßenbahnhaltestelle sitzt und nicht zu seinen Kollegen in die warme Stube der 4B will.
Im bereits erwähnten Mesopotamien des 4. Jahrtausends v. Chr. lernten die Kinder von Lehrern, die spannenderweise „Väter“ genannt wurden, rechnen, zeichnen, lesen und schreiben. Soweit der Bildungsauftrag. Was deren Erziehungsauftrag angeht, kann man nur vermuten, dass die Lehrgeschichten etwa, welche die Kinder abschreiben mussten, neben dem Schreibtraining auch noch das nötige Kleingeld in Sachen Persönlichkeitsentwicklung auf den Weg mitgegeben haben.
Im alten Ägypten war die Schule dann eine Angelegenheit für die Reichen und Schönen, und auch, wenn sich die Burschen und Mädchen beim Sportunterricht in den Tempelschulen vielleicht näher kamen, hatten sie wenig Grund zur Freude. Es herrschten Zucht und Ordnung, denn schließlich wurden sie auf ein Leben als Beamter oder sogar als Priester vorbereitet – vorausgesetzt sie waren männlich. Außerdem lernten die Kinder lesen, schreiben und rechnen, und beschäftigten sie sich mit Geographie, Geschichte, Astronomie und Kunst.

Im antiken Griechenland war die Lage ein wenig unübersichtlicher. Während im kriegerischen Sparta etwa bereits siebenjährige Burschen ihre Familien verlassen mussten, um Gehorsam, Selbstkontrolle und Teamgeist zu lernen, waren die Erziehungsmethoden in Athen durchaus gechillter: Erziehung war Privatsache und die Jugendlichen wurden eher als selbstbestimmte Individuen statt als Glieder der Gemeinschaft angesehen. Dementsprechend verhielten sich die Halbwüchsigen auch und es verwundert nicht, dass Sokrates zu solch harten Worten griff, als er die junge Generation beschrieb: „Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ Aristoteles pflichtete ihm bei: „Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.“ Daher forderten sie umgehende Bildung für alle und stießen damit die Tür für öffentliche Bildung und Erziehung weit auf. Zumindest in Griechenland.
Im Mittelalter waren es dann die Kirchen und Klöster, welche die Bildungs- und Erziehungsaufgabe übernahmen – zumindest für die Mitglieder des Adels und des Klerus – und welche damit zum ersten Mal offiziell christliche Werte in die Erziehung der Kinder und Jugendlichen einfließen ließen. Während in dieser Zeit auch die ersten Universitäten entstanden, kümmerte sich das gemeine Fußvolk indes kaum um die Erziehung der Kinder; diese kleinen Körper waren da, um bei der Arbeit zu helfen und würden schon von selbst groß werden. So oder so ähnlich beschreibt es zumindest der Historiker Philippe Ariès in seiner Geschichte der Kindheit.
Die Neuzeit brachte ein frisches Verständnis für Verantwortung und Moral mit sich und löste die erzieherische Ignoranz des Mittelalters ab. Die Familie rückte vorerst wieder in das Scheinwerferlicht der Erziehungsarbeit und sollte sich vermehrt um die geistige und körperliche Bildung ihres Nachwuchses kümmern. Wem das nicht möglich war, der überließ seine Kinder der Rohrstockpädagogik des Staates, der spätestens seit der Aufklärung ambitioniert die unbeschriebenen Blätter in seinen eigenen Interessen vollkritzelte (John Locke meinte zu dieser Zeit, dass der Mensch bei seiner Geburt eine „Tabula Rasa“ sei, also eine unbeschriebene Wachstafel, die im Verlauf seines Lebens durch seine Erfahrungen beschrieben werde). Erziehung hatte zu dieser Zeit primär zum Ziel, dass die jungen Menschen obrigkeitshörig und fromm waren. Der Rest sollte sich automatisch ergeben. Dieses erzieherische Schlachtfeld der sogenannten Pauk- und Drillschulen wurde erst von Klassenzimmergurus wie Johann Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori oder Alexander Sutherland Neill aufgeräumt. Sie schoben auf Basis ihrer Vordenker Johann Amos Comenius oder Jean-Jacques Rousseau etwa den Schulen neben der Wissensvermittlung eine weitere Verantwortung in die Schuhe: Von nun an sollten sie jedes Kind als Individuum betrachten, das durch handlungsorientiertes Lernen und dialogisches Verhandeln zu einem eigenständigen und verantwortungsbewussten Bürger der Gesellschaft herangebildet werden sollte. Na bumm! No pressure!
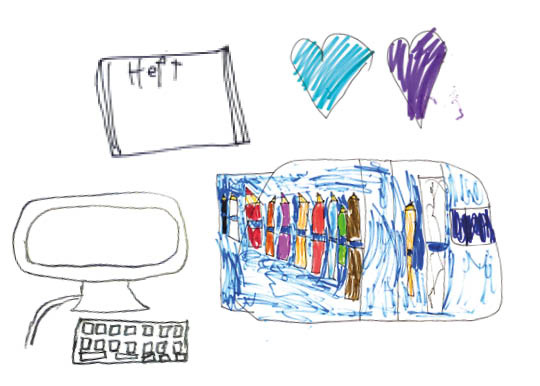
Auch wenn die Zeit des Nationalsozialismus noch einmal einen großen Einschnitt in der voranschreitenden Vorstellung davon bedeutet hat, was eine Schule zu leisten habe, manövrierte sich die Schule bis zum heutigen Tag in eine fragwürdige Richtung und bedauerliche Pattstellung: Während sie auf der einen Seite mit den stetig steigenden Anforderungen der freien Marktwirtschaft und der Standards der internationalen Bildungsmacher Schritt halten muss, hat sie andererseits das komplette Wegbrechen der ursprünglich unverzichtbaren Erziehungs- und Bildungspartner zu kompensieren: Die Familie ist in vielen Fällen entweder nicht zuhause oder nicht existent und demnach muss die Chemieprofessorin neben den Redoxreaktionen im Reagenzglas auch noch die Chemie zwischen Stephanie und Paul in die richtigen Bahnen lenken, der Sportlehrer seine Stunde um die Tatsache herum ausgestalten, dass Johannes fußballerisch und Björn gruppendynamisch ständig im Abseits stünden, und die Deutschlehrerin die gottlose Jugend in ihrem Klassenzimmer mit dem gleichnamigen Roman Ödön von Horvaths – Jugend ohne Gott – irgendwie miteinander versöhnen.
Und auch wenn es gute Gründe für die Existenz von Schulen gibt und es grundsätzlich nicht schlecht ist, wenn ausgebildete, verdiente und engagierte Pädagogen Teile der Bildungs- und Erziehungsaufgaben übernehmen, sollten Eltern sich die Frage stellen, wie weit sie ihr Privileg, ihre eigenen Kinder zu erziehen, aus der Hand geben sollen. Ja, Sie haben richtig gelesen: das Privileg, denn selbst die Vereinten Nationen haben sich in der Kinderrechtsverordnung darauf geeinigt, dass es sich hierbei um ein Privileg handelt: „Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich.“ Und sie führen bei ihrer Grundsatzentscheidung darüber, wer erster Erziehungsbeauftragter ist, einen weiteren wichtigen Punkt an: „Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.“
Das Wohl des Kindes im Fokus
Was ist nun aber mit dem „Wohl des Kindes“ gemeint? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage, stoßen wir auf eine gewisse Definitionsunschärfe beziehungsweise auf unterschiedliche Auffassungen: Tom, der sich im Übrigen immer noch auf der Bank der Straßenbahnhaltestelle den Hintern abfriert, während Paul und Stephanie im Chemiesaal der nahen Schule heimlich Briefchen hin und her schießen, würde darauf schwören, dass sowohl sein Smartphone als auch der Energy-Drink in seiner Hand zwei essenzielle Grundbausteine seines Wohlbefindens seien. Andere Jugendliche würden da vielleicht noch den sonntäglichen Ponyhofausflug, das halbwöchentliche Fußballtraining oder ihr inflationsangeglichenes Taschengeld dazuzählen.
Doch Tom – und mit ihm fast die ganze Generation – vergisst dabei leider, dass das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen oft wenig mit seinem (temporären) Wohlbefinden zu tun hat, beziehungsweise, dass seine Vorstellung von Kindeswohl meist nicht deckungsgleich mit dem ist, was tatsächlich gut für ihn und seine Zukunft ist. Ein Nachmittag zuhause bei Mathematik und Lateinvokabeln schmeckt eben nicht so gut wie karamellisiertes Popcorn im Movie-Tempel am Rande der Stadt. Ein sozialer Dienst am Samstagmorgen im schäbigen Altenheim riecht eben nicht so reizend wie das „Eau de Eislaufschuh“ der Freunde in der Garderobe der denkmalgeschützten Kunsteisbahn. Die 2000ste Wiederholung des rondoartigen Für Elise auf den Klaviertasten klingt eben eher nach der Kategorie „für den Hugo“ (österr. für nutzlos, vergeblich) statt nach einem guten Argument für Fleiß und die schönen Künste. Stattdessen downloadet er sich lieber satte Beats von Spotify und YouTube direkt in seine Gehirnwindungen. Das ist bequem und klingt auch nach was!
Das Wohl eines Kindes hat oft wenig mit seinem (temporären) Wohlbefinden zu tun.
Doch von Spotify-Klängen, Eislaufnachmittagen und Popcorn macht das älteste gültige Gesetzbuch des deutschen Rechtskreises, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, beispielsweise bei der Beschreibung des Begriffs „Kindeswohl“ keinen Pieps. Dort liest man stattdessen, dass angemessene Versorgung, sorgfältige Erziehung, Geborgenheit und Wertschätzung, die Gewährleistung von Entwicklungsmöglichkeiten, die Berücksichtigung der Meinung des Kindes, die Vermeidung von Gefahren und die Wahrung der Rechte des Kindes, zum Wohl unseres Nachwuchses beitragen würden. Weiter in die Zukunft (oder in das Metaphysische) gerichtete Blicke würden dann vielleicht noch die Entwicklung von Talenten und Charismen, von einem Verständnis für die Bestimmung des Menschen, von einer Vision und Richtung für das Leben und von einem Sinn für das Übernatürliche, das Ewige, freilegen. Die Blicke würden den Anspruch für sich erheben, im Menschen mehr zu sehen als ein Echo der gesellschaftlichen Entwicklungen, mehr zu sehen als Mittelmäßigkeit und Selbstzufriedenheit, mehr zu sehen als Antriebslosigkeit und Resignation.
Wie die Welt verändern?
Die Familie bietet eben den Rahmen für eine Erziehung und Bildung, die den Boden für Weltveränderung bereitet; selbst die Größten von uns sind durch die Schule der Familie gegangen. Manche von ihnen sogar länger als erwartet. Raphael Nadal lebte beispielsweise bis 2019 mit seinen Eltern unter einem Dach. Bradley Cooper genießt Hotel Mama immer noch. Jesus hat es auch 30 Jahre lang zuhause ausgehalten – kein Wunder, bei den Eltern, könnte man meinen! Und als es dann Zeit für ihn war, die Welt zu verändern, hat er das Modell der Familie übernommen und eine Handvoll Menschen um sich geschart, die vom Leben mit ihm lernen sollten. Aus den zwölf Aposteln hat er wiederum drei auserwählt, denen er besondere Aufmerksamkeit schenken wollte.
Und auch wenn es gute Gründe für die Existenz von Schulen gibt [ . . . ] sollten Eltern sich die Frage stellen, wie weit sie ihr Privileg, ihre eigenen Kinder zu erziehen, aus der Hand geben sollen.
Die Vorlage ist einfach: Investiere in eine Handvoll Menschen deine ganze Liebe und Energie und ermögliche ihnen dadurch ein Rückgrat zu entwickeln, das den Stürmen der Zeit standhält und die Geschicke der Welt lenken kann. Was sie in der Schule lernen, ist wichtig, keine Frage. Doch viel wichtiger als die Frage, wie ich richtig Vokabel lerne ist jene, was ich mit den Wörtern ausdrücken möchte, die ich in den Mund nehme. Viel wichtiger als die Funktion eines Winkels berechnen zu können, ist zu verstehen, welche Funktion ein freundlicher Mundwinkel in der Gesellschaft haben könnte. Viel wichtiger, als einen Felgaufschwung am Reck machen zu können, ist es, die Menschen um mich herum zu einem emotionalen Aufschwung zu führen. Und diese Dinge lerne ich am ehesten durch Nachahmung der Menschen, die ihr Leben dafür aufs Spiel setzen, dass aus mir etwas Großes wird.
Und das ist die Botschaft, die auch Simon und Simone aus dem prähistorischen Südafrika, Paul und Stephanie im Chemiesaal des pädagogischen Plattenbaus und Tom an der feuchtkalten Straßenbahnhaltestelle hören muss: Du bist geliebt! Auf dich kommt es an! Lass mich dir helfen, deine Bestimmung zu finden!
Eltern, worauf warten wir? Lasst uns heute damit beginnen. Sobald die Kinder von der Schule zuhause sind.



























